[ENGLISH]
Helena Parada-Kim (b. 1982 in Cologne, Germany) implements stylistic and content-related influences in new cultural contexts resulting in masterful works that are complex in terms of both content and form.
The Dead Man, 2016, resembles The Dead Toreador (Homme Mort) by Manet, who was heavily influenced by Spanish painters such as Velásquez when he produced this work. Just as Manet incorporated Spanish clothing and culture into his work, Parada-Kim does the same in The Dead Man with her depiction of her brother dressed in a Hanbok, a traditional piece of Korean clothing, drawing from her Korean roots. Unlike Manet, Parada-Kim’s The Dead Man depicts not a dead toreador laying on the ground, but her brother dressed in hanbok belonging to a dead relative.
Wedding Duck, 2016, can be seen on its own or in connection with Parada-Kim’s The Dead Man. The work depicts a wooden goose (kirŏgi in Korean; a duck is often used instead of a goose). It is Korean tradition that a groom should gift both a male and female wooden goose or duck to his future in-laws to symbolise his lifelong faithfulness, loyalty and harmony.
The Dead Man and Wedding Duck are typical examples of Parada-Kim’s recent practice, in which recurring themes include the artist’s personal environment, blending of cultural influences, history, and narrative elements.
Other works displayed in the exhibition include a portrait of a Korean grandmother painted on a cardboard box used to ship goods from Korea to Germany, a painting of various magnificent hanboks garments, and portraits of a mourner from a bygone age and a Catholic Korean lady in a hanbok and lace veil.
Gorka Mohamed (b.1978 in Santander, Spain) lives and works in London. Mohammed’s works are distinguished by an ambiguity that makes it difficult for the viewer to class them as just one art genre. They contain a mixture of surrealism and the Spanish Baroque creating dark cartoon-like figures.
Intense colours and seemingly unconnected objects come together to create single figures resembling a two-dimensional sculpture, which characterise his paintings.
At the group exhibition MANMADEGOD in 2012, he and three other artists of different origins reinforced the philosophical problems that occur when an artist sees themselves as creators, challenging the principle of God. What are the consequences of this? Do we lose perspective?
Mohamed labels his works as social structures into question and is not afraid to make existing power structures look ridiculous.
Are we humans becoming more and more apathetic? Are we interested in anything anymore or have our heads become so full from the floods of information. Advertising and trivial entertainment bombard us and at the end of the day would we rather immerse ourselves in the comfort of passivity than challenge the status quo?
These are introspective questions sprung from the bright mind of a contemporary Spanish artist who has found an ideal catalyst for further discussion on canvas.
[DEUTSCH]
Helena Parada-Kim (*1982 in Köln) versteht es, verschiedene stilistische und inhaltliche Einflüsse in neue kulturelle Kontexte zu setzten, wodurch meisterhafte Arbeiten entstehen, die in ihrem Inhalt und ihrer Form vielschichtig sind.
„The Dead Man“ (2016) zitiert „Homme mort“ von Manet, der zur Zeit der Entstehung seines Bildes stark von spanischen Malern wie Velásquez beeinflusst war. Auf dem Boden liegt jedoch kein toter Torero, sondern ein junger Mann, der einen Hanbok, ein traditionelles koreanisches Kleidungsstück, trägt. Ähnlich wie Manet sich auf spanische Kleidung und Kultur bezieht, verwendet Helena Parada-Kim koreanische Kleidung und Kultur. Es ist der Bruder der Künstlerin, der am Boden liegt, gekleidet im Hanbok eines toten Verwandten.
„Wedding Duck“ (2016) kann man einzeln, aber auch im Zusammenhang mit „The Dead Man“ betrachten. Es zeigt eine hölzerne Wildgans (koreanisch kirŏgi; oft auch als Ente dargestellt), wie sie traditionell bei koreanischen Hochzeiten verwandt wurde. Früher brachte der Bräutigam eine solche Gans in das Haus seiner zukünftigen Schwiegereltern, um seine Treue und Verbundenheit zu symbolisieren. Als Paar, bestehend aus einem männlichen und einem weiblichen Vogel, sind die hölzernen Figuren auch heute noch beliebte Hochzeitsgeschenke, da sie lebenslange Treue und Harmonie symbolisieren. Setzt man beide Bilder in Verbindung, so entsteht eine Narrative.
„The Dead Man“ und „Wedding Duck“ sind beispielhaft für die aktuellen Werke von Helena Parada-Kim, in denen wiederkehrende Aspekte das Aufgreifen des persönlichen Umfelds, das Vermischen von kulturellen Einflüssen, das Erarbeiten von Kultur und Geschichte und das erzählerische Moment sind. So auch in anderen in der Ausstellung gezeigten Portraits: Dem der koreanischen Großmutter, auf einen Pappkarton gemalt, der zum Versenden von Ware oder Geschenken von Korea nach Deutschland verwandt wurde, den verschiedenen prächtigen Hanboks, dem des Trauernden aus einer längst vergangenen Zeit oder dem Portrait der katholische Koreanerin in Hanbok und Spitzenschleier.
Gorka Mohamed (*1978 in Santander, Spanien) lebt und arbeitet in London. Seine Werke sind von einer Ambiguität geprägt, die es dem Betrachter schwer macht, sie in nur eine Kunstrichtung zu kategorisieren; man findet eine Mischung aus Surrealismus und spanischem Barock, gepaart mit düsteren, comichaften Figuren.
Starke Farben und viele, scheinbar zusammenhangslose Gegenstände, die sich zu einer Figur fügen und so einer zweidimensionalen Skulptur ähneln, zeichnen seine Gemälde aus.
In der Gruppenausstellung „MANMADEGOD“ (2012) vertiefte er zusammen mit drei weiteren
Künstlern unterschiedlicher Herkunft die philosophische Problematik, die entsteht, wenn sich Künstler als „creators“ sehen und somit das göttliche Prinzip herausfordern. Welche Konsequenzen zieht dies nach sich? Verlieren wir die Perspektive?
In seinen Arbeiten stellt er Gesellschaftsstrukturen in Frage und scheut sich nicht davor, bestehende Machtstrukturen in Lächerliche zu ziehen.
Werden wir Menschen immer apathischer? Interessiert uns überhaupt noch irgendetwas oder sind unsere Köpfe durch die tägliche Flut von Informationen, Werbung und belanglosem Entertainment so schwer geworden, dass wir am Ende des Tages lieber in den Komfort der Passivität eintauchen statt den Status quo anzufechten?
Introspektive Fragen, die dem hellen Geist eines zeitgenössischen spanischen Künstlers entspringen und auf der Leinwand einen idealen Katalysator für weitere Diskussionen gefunden haben.
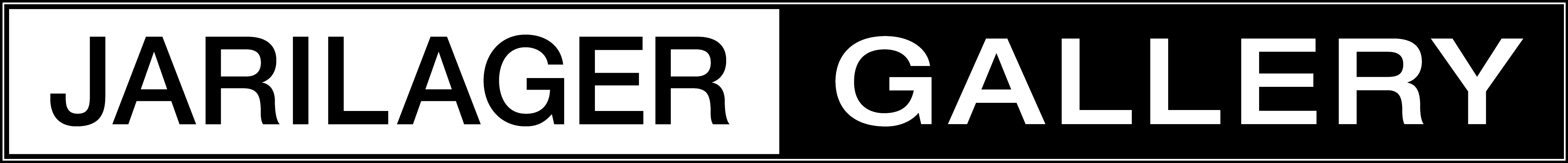
![[COLOGNE] HELENA PARADA-KIM & GORKA MOHAMED , HELENA PARADA-KIM & GORKA MOHAMED](https://artlogic-res.cloudinary.com/w_800,h_800,c_limit,f_auto,fl_lossy,q_auto/ws-artlogicwebsite0781/usr/exhibitions/images/exhibitions/69/2.jpg)